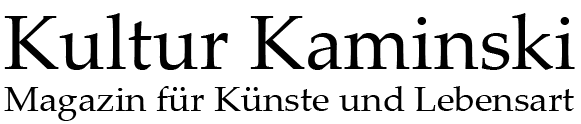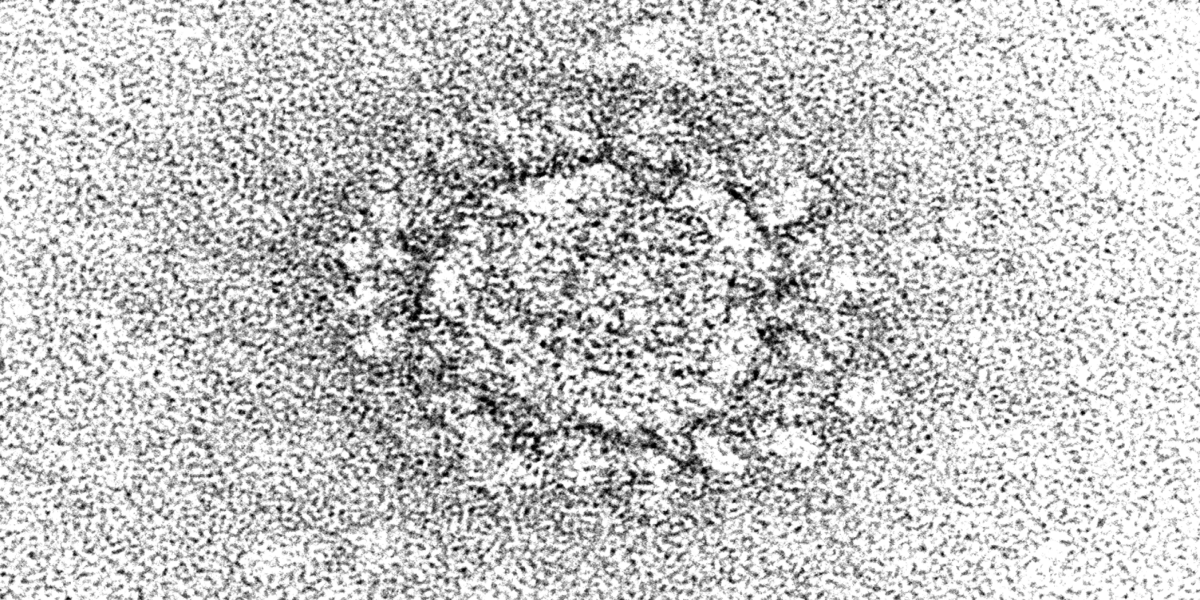Untergeordneter Gebäudeteil übernimmt Hauptaufgaben
Das Querhaus der Lateranbasilika genießt einen hohen Grad von Autonomie. Fast darf es als selbstständiges Kirchengebäude gelten. Seit der ausgehenden Renaissance ersetzte seine Nordfassade die vom Mittelalter bis zur Barockisierung unansehnliche Hauptansicht im Osten. Falls die frommen Wallungen Besuchende nicht völlig erfüllten und Gelegenheit zu ästhetischer Wahrnehmung erübrigten, wird sich der angesichts der dort obwaltenden Dürftigkeit Enttäuschung eingestellt haben. Der traurige Anblick des Außen und Innen von Mittelschiff und Seitenschiffen beförderte die zunächst nicht absehbare Karriere des Quertrakts. Wenig nur griffen die konstantinischen Flügel über die Breite der Basilika hinaus, besser wäre von bloßen Anräumen zu sprechen. Erst am Ende des 13. Jahrhunderts waren sie unter Nikolaus der IV. zum tatsächlichen Querhaus erweitert und im Norden durch ein Paar zierlicher Türme ausgezeichnet worden.
Ähnlich enttäuschend wie der Hauptzugang im Westen, blieb bis auf ein wenig spektakuläres Portal und ein bescheidenes Rundfenster darüber die Nordfassade kahl. Neben ihr hatte indessen wenig später Bonifatius VIII. eine vom Konzilssaal des Lateranpalastes aus zugängliche filigrane Benediktionsloggia errichten lassen, aus der er im von ihm ausgerufenen ersten Heiligen Jahr 1300 den papalen Segen erteilte. Jenes an den zweiten Pfeiler der rechten Mittelschiffseite transferierte Freskofragment, dessen Qualität die Zuschreibung an Giotto rechtfertigt, zeigt Bonifatius VIII. in eben dieser Loggia. Die Ähnlichkeit mit Arnolfo di Cambios heute im Museum des Florentiner Doms befindlichen Bildnis des Tiaraträgers erlaubt die Identifizierung; nicht anders dessen Wappen am Behang der Loggiabrüstung. In der Verlagerung der päpstlichen Segenspendung auf die Nordseite des Laterankomplexes begriff beinahe drei Jahrhunderte später Sixtus V. den Impuls zur Aufwertung der benachbarten Querhausfassade.
Der Papst befahl die Straßenführung aus dem Stadtzentrum darauf auszurichten (die heutige Via Merulana). Auch ließ er den aus dem Circus Maximus nach hier transferierten Obelisken aufrichten. Überdies gebot er den Abriss des alten Lateranpalastes samt Segensloge. Sein leitender Architekt Domenico Fontana ersetzte ihn durch den gegenwärtigen. Unmittelbar daran schließt Fontanas neue dem Querhaus vorgeschaltete hochelegante Benediktionsloggia. Ihrer Bestimmung übergab sie Sixtus V., als er von ihr herab an Ostern 1587 den Segen „Urbi et orbi“ erteilte. Die Baugestalt überzeugt: Schlank und feingliedrig nehmen die beiden gleich hohen Arkadengeschosse das Grazile der mittelalterlichen Zwillingstürme über ihnen auf. Doppelpilaster akzentuieren die Ränder, einfache trennen die Bögen. Zierliche Balustraden füllen die Räume zwischen den Pfeilern, eine gleichartige, doch durchlaufende krönt Fontanas Segensloge.
Der schlichte Segmentbogengiebel vermittelt zwischen Neubau und Zwillingstürmen. Hinter den Erdgeschossarkaden flankieren das Hauptportal zwei weitere Zugänge. Gelegentlich hatte Fontana – etwa in der Krypta des Domes zu Amalfi – dem Manierismus gehuldigt, an der Benediktionsloggia der Lateranbasilika findet sich keine Spur davon. Vielmehr spiegelt deren – freilich raffinierte – Einfachheit und Fasslichkeit die Forderungen des Trienter Konzils als Antwort auf die Reformation auch in Gottesdienst und Kirchbau. Der franziskanisch gesonnene Sixtus V. hing den Maßgaben entschieden an. Die Bildenden Künste eingeschlossen. So schildern denn die Fresken in den Lünetten des Obergeschosses die sieben Szenen aus dem Leben Konstantins des Großen – anstatt manieristisch-verkompliziert – linear-direkt.
Repräsentationssaal der Gegenreformation
Das Innere des Querhauses bietet nur unter Bedingungen den Anblick einer Kirche. Zwar zieht augenblicklich das riesenhafte Ziborium des vor der südlichen Stirnwand ragenden Sakramentsaltars die Aufmerksamkeit an. Doch gleicht der Raum dessen und der religiösen Sujets der Skulpturen und Gemälde unerachtet alles in allem einem Saal zu profanem Repräsentieren. Erlauben romanische, gotische oder barocke Sakralräume keinen Zweifel an ihrer gottesdienstlichen Bestimmung, so gestattet das Querhaus der Lateranbasilika, sich in päpstlichem Prunkgemach zu wähnen, etwa der Sala Regia im Apostolischen Palast oder der Sala Clementina ebendort. Letztere benannt nach Papst Clemens VIII., dem Auftraggeber auch zur völligen Neugestaltung des Querhauses seiner Bischofskirche im Lateran.
Welches daher oft unter Nave Clementina firmiert. Im Zeichen des Trienter Konzils und seiner Kampfansage wider den Protestantismus erwies sich dieser Papst als Sixtus‘ V. treuer Nachfolger. Um die Liturgie und das Gebetsleben seiner Geistlichen vom Kardinal bis hinab zum Leutepriester zu ordnen, verfügte er Neuausgaben des Pontificale Romanum und Caeremoniale Episcoporum für die Prälatenränge (Buch zum Gebrauch in der bischöflichen Liturgie und Vorschriftensammlung) sowie des Missale und Breviale Romanum (Messbuch und Buch für die Stundengebete) für alle geistlichen Weihegrade. Was Clemens VIII. unter guter Ordnung verstand, beherrscht gleich Liturgie und Gebetsleben die Ausstattung des Querhauses der Lateranbasilika. Ratio und reicher Schmuck schlossen sich dabei keinesfalls aus, präsentierten sich vielmehr innig verschwistert.
So korrespondieren denn denkbarste Einfachheit der Architektur und reicher bildnerischer Ornat. Zum Heiligen Jahr 1600 sollten Pilgernde die päpstliche Auslegung der Trienter Konzilsbeschlüsse in Altarbau- und Bildkunst übertragen erleben. Des Papstes Chefarchitekt Giacomo della Porta und sein bevorzugter Maler Giuseppe Cesari wirkten zusammen. Der Baumeister vereinheitlichte die Höhe der Bogenöffnungen zu Seitenschiffen, Kapelle im Nordwesten Chorumgang und Verbindungsgang zur Sakristei. Den Zwischenraum der Arkaden füllen reich ornamentierte Marmorvertäfelungen, über denen in mannigfaltigen Haltungen hochreliefierte Engel sich die Eucharistie verehrend in Richtung Sakramentsaltar wenden. Oberhalb der Arkaden schloss della Porta die mittelalterlichen Fenster, um acht neue wie Ädikulen gerahmte einzupassen. Sie garantieren den reibungslosen Ablauf des von Cesari koordinierten Bildprogramms der bis dicht unter die neuen Lichtöffnungen reichenden großformatigen Historiengemälde. Ferner Ganzfiguren des Täufers, der Apostel und Kirchenlehrer in der Fensterzone. Fresken, von nämlicher Hand wie die monumentalen Schilderungen der Geschichten von Konstantins Bekehrung und der Lateranbasilika unterhalb.
Auf dass der Querschiffraum plastischer durchformt wirke, wecken sie den Anschein, sich hinter zurückgeschlagenen, tatsächlich aber gemalten Vorhängen zu befinden. Bis zu den Monumentalhistorien selbst fährt der Illusionismus fort. Denn nicht wollen in ihnen Gemälde betrachtet sein, vielmehr – kostbarer noch – Tapisserien. Breite die jeweiligen Szenen rahmende Bordüren, auf denen erlesene Ornamentik für sich einnimmt, tragen wesentlich zur bildteppichhaften Vortäuschung bei. Vom Süden gen Norden schildert auf der linken Seite Bernardino Cesari, Giuseppes Bruder, den Triumphzug Kaiser Konstantins, nachdem er seinen Widersacher Maxentius an der Milvischen Brücke im Zeichen des Kreuzes besiegt hatte, Cesare Nebbia, wie Peter und Paul dem Herrscher im Traum erscheinen, von nämlicher Hand, wie der vor der Christenverfolgung auf den Monte Soratte im Tibertal geflohene Papst Silvester zu Konstantin nach Rom entboten wird und – Höhepunkt der Bildfolge – Cristoforo Roncalli des Kaisers Taufe eben durch Papst Silvester.
Auf der rechten Wand setzt von Norden nach Süden Paris Nogari die Gründung der Lateranbasilika ins Bild. Die beiden anschließenden Fresken erzählen vom Weihegottesdienst der Kathedrale am neunten November 324, dem der ganzen katholischen Christenheit gebotenen Hochfest: Giovanni Battista Ricci vergegenwärtigt die Konsekrierung des Altars, Giovanni Baglione zeigt die Erscheinung der aus Gewölk ragenden Christusbüste vor Papst, Kaiser und allem Volk. Baglione führt ferner die Konstantinische Schenkung auf Basis jener angeblich vom Kaiser ausgestellten, tatsächlich aber um 800 gefälschten Urkunde vor Augen, in der Papst Silvester und sämtlichen seiner Nachfolger im Petrusamt die geistliche Herrschaft über den Erdkreis, zudem die weltliche über weite Gebiete Italiens zuerkannt wird.

Alle Maler dieser für die Geschichte des Christen- und Papsttums entscheidenden Initialszenen kamen vom Manierismus her. Doch finden sich davon nurmehr Spuren. Die gewollten, oft ertüftelten Überkomplexitäten in Bildaufbau und Figurenauffassung sind Klarheit und leichter Lesbarkeit gewichen. Was aus der manieristischen figura serpentinata, der virtuos in sich gewundenen Gestalt, wurde, weist sich in Roncallis „Taufe Konstantins“: unverkennbar die Herkunft des Täuflings von der figura serpentinata, ebenso offensichtlich ihre Entwindung daraus zur Klarheit des Umrisses.
Didaktik und Akademismus bestimmen hier wie auf Roncallis Fresko überhaupt und dessen sämtlichen Nachbarn. Eine gewisse Anspruchslosigkeit macht sich breit. Selbsterklärende Deutlichkeit gegenreformatorischer Propaganda rangierte vor künstlerischer Ambition. Das Inbild der neuen Selbstbescheidung schuf der Koordinator solch malerischer Demut höchstselbst: Giuseppe Cesari. Seine Himmelfahrt Christi nimmt die gesamte Südwand oberhalb Sakramentsaltar-Ziboriums ein. Der Bildaufbau ist klar und deutlich, die Farbpalette wenig differenziert. Glanz und Fülle des Ereignisses werden eher behauptet denn beglaubigt. Der gen Himmel steigende Christus zitiert Rafaels zum Halbakt umformulierte Transfiguration. Doch findet sich nichts von der bestimmten Zartheit der Umrisse und Modellierung des Vorbilds. Vielmehr verschafft sich harmlos-wässrige Weichheit Geltung.
Gegensätzlich zur Transfiguartion erhebt sich Christi Blick nicht zum Himmel, sondern senkt sich auf zwei den Aposteln das Ereignis weisende Engel sowie die bass erstaunte und mehrheitlich kniende Schar der – nach Judas‘ Verrat – übrig gebliebenen Elf. Noch auf den Knien, schickt Petrus sich mit seiner Rechten schon zum Segen an, den er als Christi irdischer Statthalter über die Menschheit austeilen wird. Des Freskos Lehrhaftigkeit entsprach exakt dem, was der Papst von der Kunst erwartete: Clemens VIII. adelte Cesari zum Cavalier d’Arpino.
Doppelanlage aus Altar und Tabernakel
Zwar ließ das Trienter Konzil der Heiligenverehrung weiterhin ihren Lauf, doch rückte es das Altarsakrament neuerlich dorthin, wo sein eigentlicher Platz ist, ins Zentrum des Glaubenslebens. Während das Ziborium über dem Papstaltar im Hauptschiff der Lateranbasilika mit den Schädelreliquien Petri et Pauli prangt und daher sich eignet, um vom Kerngeschehen der Messe abzulenken, richtet sich -wie schon sein Name sagt – der Sakramentsaltar völlig auf die Eucharistie hin aus. Sein Architekt Pier Paolo Olivieri stand in engem Benehmen mit della Porta. Welch‘ Letzterer die Wandgliederung des Querhauses zu Seiten des Altars in eine offenbar den Kaiserforen, vor allem dem des Augustus, abgeschaute Rahmenarchitektur überführte. Gleichwohl hätten Säulenstellungen wie auf dem Augustusforum zu einem Bruch in der Wandabwicklung geführt, den Rang des Altars angetastet und ferner übermäßigen Platz beansprucht. Della Porta beschied sich daher mit Pilastern, auf die er ein Gesims legte.

Sakramentsaltar, der Name scheint einzig den Ort zu bezeichnen, an dem sich nach katholischer Auffassung die Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi ereignet, doch bezieht die Benennung ferner die dahinter situierte Architektur für den Tabernakel, den Schrank also für die geweihten Hostien, und diesen selbst ein. Della Porta schuf mithin eine Doppelanlage aus Altar und Tabernakel. Beide Fassaden gleichen sich in Grund- und Aufriss: Zwei von Pilastern hinterfangene Säulenportikusfassaden schieben jeweils einen Mittelrisalit aus sich heraus. Des Ziboriums Maße reichen an die der Front eines kleinen antiken Tempels, die um einiges schmalere und deutlich weniger tiefe den Schrein für das geweihte Brot bergende Fassade an die einer monumentalisierten Ädikula. So fusioniert denn Olivieris Doppelanlage inhaltlich Altar und Tabernakel, formal vereinigt er die Abmessungen von Tempel und tempelförmiger Nische.
Die sieben Meter hohen Säulen des Ziboriums bestehen aus vergoldeter Bronze. Ihre Schäfte und eines der Kapitelle sind römische Spolien des frühen zweiten Jahrhunderts von ungewisser, doch sicher immens reputierlicher Herkunft, die einzigen Zeugnisse tragender Elemente römischer Baukunst in Bronze. Die stilistische Datierung widerlegt fromme Erzählungen, nach denen sie dem Jerusalemer Tempel oder mindestens einem Siegesmonument des Kaisers Augustus entnommen sein sollen. Legenden mutmaßen das Innere mit Erde von Golgota oder ähnlich geweihtem Ort befüllt. Wohl im Mittelalter wurden die Säulen in die Lateranbasilika überführt, wo sie jahrhundertelang paarweise den Papstaltar flankierten. Bis Oivieri sie auf Weisung Clemens VIII. dem Ziborium des Sakramentsaltars einfügte. Olivieri reüssierte. Seither nimmt sich das Säulenquartett wie eigens für die neue Bestimmung geschaffen aus.
Den Portikus für den Tabernakel durchtakten vier Säulen aus grünem Marmor (verde antico). Einst sollen sie die Seitenschiffe der konstantinischen Basilika voneinander getrennt haben. Später habe sich auch Borromini zur Einfassung seiner Monumentalnischen im Mittelschiff aus diesem Fundus bedient. Attestiert Ingo Herklotz in seiner Besprechung einer im Jahr 2020 erschienenen Monographie über die Lateranbasilika „den neuerdings so beliebten Säulenforschungen, die der Provenienz und dem Verbleib einzelner Marmorschäfte nachspüren“, sei „viel Gewicht“ beigemessen, dann darf das >Zu< getrost ergänzt werden. Des Stilkundlers damit einhergehendes – gar nicht implizites – Naserümpfen ist unangebracht. Beispielhaft erweist sich das eben an den Säulen aus verde antico, einer – wie schon der Name sagt – Marmorart grüner Farbe. Zwar taugen sie hervorragend zu den monumentalen Würdeformeln in Olivieris und Borrominis Ädikula-Architektur, doch scheint ihre Höhe für die wechselseitige Abtrennung der Seitenschiffe zu gering.
Da ist noch eine Menge Forschung zu leisten. Sei dem, wie ihm sei: Links vom eigentlichen Tabernakelgehäuse positionieren sich Olivieris lebensgroße Standbilder Aarons und des alttestamentlichen Priesterkönigs Melchisedek, rechts Mose und Elias. Im Brüderpaar des Exodus, ihrer Personalunion aus geistlichen und weltlichen Gebietern, sahen die Päpste Amtsvorgänger. Wie im gleichgearteten Amt Melchisedeks, der ferner das Abendmahl präludierend zur Begrüßung des Erzvaters Abraham den Segen über Brot und Wein sprach. Des Propheten Elija Auffahrt gen Himmel weist auf Christi Himmelfahrt voraus. Das kostbare Behältnis für die transsubstantiierten Hostien erstreckt sich aus zurückhaltend profiliertem Marmorrahmen in den Risalit des Säulenportikus hinein. Analog zur Jerusalemer Grabeskirche, ein Oktogon. Indessen um zwei seitliche Stutzflügel ergänzt. So umgibt denn den – nach katholischem Dafürhalten – Leib Christi ein Schrein aus Marmor, Silber und vergoldeter Bronze, von dessen Kuppel der Auferstandene himmelwärts steigt. Nischen bieten weiteren Statuetten Raum.
Virtuos kombinieren die Goldschmiede Pompeo Targone und Curzio Vanni die unterschiedlichen Materialien zur sich wechselseitig steigernden Einheit. Während einerseits die hinterfangende Nische auf ein in die Wand eingelassenes Depot für das – wie Katholiken es bezeichnen -Allerheiligste deutet, gewinnt das Behältnis andererseits durch sein Ausgreifen in den Risalit frei im Raum stehende Qualität. Weder zum Typus des Wand- noch des freistehenden Tabernakels zählend, eignet dem Oktogon etwas solcher Indifferenz halber Schwebendes. Über dem Hostienschrein befindet sich ein aus einer Silberplatte getriebenes und vergoldetes Relief, auf dem lebensgroße Figuren sich zum Letzten Abendmahl versammelt haben. Curzio Vannis Original, das Jesus Brot und Wein segnend zeigte, ging wie die edelmetallenen Büsten der Apostelfürsten aus dem Reliquienrepositorium des Papstaltars zur Ablösung napoleonischer Kontributionsforderungen verloren. Wohl im Schmelzofen. Das gegenwärtige Relief ist eine fade Arbeit der 1860er Jahre. Kelch und Schale rahmend, breitet der Erlöser auf dem Tisch seine Hände aus.
Obschon zwei der statischen Notwendigkeit willfahrende Engel das Relief halten, dünkt es – unerachtet seiner künstlerischen Nachrangigkeit – epiphan, mithin schwebend wie der Tabernakel-Schrein. Hinter Heiland, Aposteln und einer Glasscheibe ist ein textiler Vorhang angebracht. Geöffnet, gestattet er der den Blick auf zwei Zedernholzbretter, nach alter Überlieferung die Tischplatte aus dem Abendmahlssaal. Die Reliquie soll Kaiser Titus infolge der Zerstörung Jerusalems im ersten Jüdischen Krieg als Beute nach Rom entführt haben. Völlig abwegig scheint das nicht. Zwar prangen die Zedernholzbretter nicht wie die Heiligtümer aus dem Jerusalemer Tempel auf dem berühmten Relief im Durchgang des Titusbogens. Indessen lässt sich dem Kaiser durchaus unterstellen, das Judentum in allen seinen Glaubensrichtungen – die christliche eingeschlossen – in den Staub zu treten. Gleichviel, ihren Reliquienrang bezieht die Lateranbasilika ganz wesentlich aus zwei hölzernen Tischplatten: der in den Papstaltar eingelassenen Mensa, an der Pontifex Maximus Silvester, des Gotteshauses Erstvorsteher, höchstselbst zelebriert haben soll und – weit darüber hinaus – jener Zedernholztafel, woran – wie die fromme Tradition möchte – der Religionsstifter selbst die Einsetzungsworte über Brot und Wein sprach. Anders als die im Ziborium über dem Papstaltar aufgestellten Schädeln der Apostelfürsten, lenkt die Herrenreliquie aus dem Abendmahlssaal nicht vom eucharistischen Geschehen ab, vielmehr dient sie zum Zeugnis und zur Bekräftigung dessen, was sich drunten am Altar vollzieht.
Wahrlich, hier am Sakramentsaltar im Querhaus der Lateranbasilika gipfelt die durch das Trienter Konzil gebotene Wiedererhöhung des Altarsakraments früh und ferner in seiner Inszenierung nie wieder erreicht. Suggestiv zieht zentralperspektivisch und in der Staffelung von Tempelfront und architektonisch analog disponierter Ädikula der Sakramentsaltar Blick und Gemüt der – dies vorausgesetzt – Gläubigen auf das Geheimnis von Christi Leib und Blut hin. Mag immer dem Altargiebel die Bekrönung durch überlebensgroße Bronzestandbilder des zum Himmel auffahrenden Christus und der beiden Johannes (Baptista et Evangelista) vorenthalten worden sein. Dies, weil bei seinem Besuch am dritten Januar 1599 Clemens VIII. die in der Lateranbasilika aufgestellten originalgroßen Tonmodelle missfielen. Das Ansinnen war erledigt. Ob sie den Blick auf Giuseppe Cesaris Himmelfahrt verwehrt hätten oder das Riesenfresko nach Abkehr vom Plan zur Statuenaufstellung als „Notlösung“ zur Füllung der enormen Wandfläche über dem Ziborium dienen musste, ist ungewiss. Zumal keine Aufgabe ersichtlich ist, mit der sich der die malerischen Arbeiten in der Nave Clementina koordinierende Cesari sonst vor den Kollegen hätte auszeichnen dürfen.
Spätestrenaissance als Neorenaissance
Wenden sich Besuchende vom Sakramentsaltar zur Eingangsseite um, erblicken sie auf einer Empore über den Portalen die gewaltige, die ganze Breite der nördlichen Stirnwand einnehmende Orgel. Bei ihrer Einweihung im Jahr 1599 die größte der Christenheit. Clemens VIII. hatte dem Orgelbauer Luca Biagi den Rekord befohlen. Die 49 Pfeifen der Schaufront des Instruments beziehen sich auf die Anzahl der Jahre, nach deren Ablauf das Alte Testaments jenes Jubeljahr vorschrieb, von dem die Päpste den Turnus der Wiederkehr des Heiligen Jahres herleiteten. Girolamo Frescobaldi spielte auf dem Instrument und – nach dem 1676 erfolgten Umbau durch Giuseppe Testa – im Jahr 1707 Georg Friedrich Händel. Mochte immer das Trienter Konzil auf Wortverständlichkeit der Vokalmusik drängen und der Orgel effekthascherisches Gebrause untersagen; Virtuosität zu beweisen, fand sich dennoch Gelegenheit. Auf die Auslegung der Vorschriften kam es an. Ferner soll nicht vergessen sein, dass Biagis Instrument für die gesamte Lateranbasilika ausgelegt ist. Will heißen, auch zu den Gottesdiensten am Papstaltar ihren Dienst leistet.

Den Orgelprospekt entwarf Giacomo della Porta. Nachdem er bei der Umgestaltung der Querhauswände große Zurückhaltung geübt, dort die Fresken hatte dominieren lassen müssen, überdies der Sakramentsaltar nicht sein Werk war, legte sich des Papstes leitender Architekt nun wenig Zwang auf. Prunkvollste Loggienarchitektur war das Resultat. Begleitet von zwei mit Pilastern hinterlegten Säulen, öffnet sich die risalitartig vortretende Mittelarkade. Darin hineingesetzt lenkt eine dreiteilige Bogenstellung in goldschmiedehafter Anmutung den Blick auf das dahinter befindliche Instrument. Eine Kombination aus Voluten- und Segmentbogengiebel setzt dem Zentrum von Della Portas Orgelprospekt die Krone auf. Schmale Säulen fassen die beiden mit Dreiecksgiebeln schließenden Seitenflügel ein.
Ähnlich der unter dem Mittelbogen, nur um ein Geringes bescheidener in Disposition und Zierrat, steigert eine dreiteilige Arkatur die Eleganz der Orgelpfeifen in ihrem Rücken. Alles dies scheint reichlich erklügelt. Was unbegrenzte ars combinatoria baukünstlerischer Elemente und nie versiegende Mannigfaltigkeit ornamentalen Einfallsreichtums beweisen möchte, weckt Assoziationen mit Baukästen und nicht allein die Schmuckformen anlangendem horror vacui. Fast verführt Fülle wie diese zur Verwechslung von Della Portas Spätestrenaissance mit Logentheatern im Neorenaissance-Historismus des 19. Jahrhunderts. Fürwahr kündigt der Orgelprospekt der Lateranbasilika der zeitgleich erfundenen Oper mindestens jene dann gründlich säkularisierte Architektur an, wie sie im Pariser Palais Garnier kulminieren wird.
Wiederaufwertung gegenüber dem Petersdom
Außer dem cum grano salis erhaltenen konstantinischen Grundriss wahren einzig die durch Mittelschiff und Querhaus ausgespannten hölzernen Flachdecken aus des 16. Jahrhunderts zweiter Hälfte die bauliche Einheit der Bischofskirche des Papstes. Lang- und Querhaus müssten sonst stilistisch völlig auseinanderfallen. Indes datiert der Plafond des Letzteren um drei Jahrzehnte jünger als der im Mittelschiff. Mit dem Entwurf der Querhausdecke betraute Clemens VIII. den Florentiner Bildhauer Taddeo Landini. Wer die Ausführung der Schnitz- und Schreinerarbeiten leitete, ist unbekannt. Die Decke der Nave Clementina war 1595 fertiggestellt. Auf der Längsachse erstrecken sich drei von kleineren Feldern gerahmte Rechtecke. Im nördlichen und südlichen Karree prangt jeweils das Wappen Clemens VIII., in den L-Einfassungen und Nebengevierten umgeben von liturgischen Geräten und Leidenswerkzeugen Christi und jener Märtyrer, deren Reste in die Lateranbasilika überführt worden waren.
Das in zwei Quadrate teilbare Rechteck in der Vierung überbietet samt übriger Disposition seine beiden Nachbarn durch figuralen und ornamentalen Reichtum. Wie im Apsismosaik und auf einem der Querhausfresken begegnet dort – nun in Relief – jene Christusbüste, die Papst, Kaiser und allem Volk bei der Weihe der Lateranbasilika erschienen sein soll. Das zentrale Geviert flankieren im Profil die Reliefbüsten Peters und Pauls. Ihnen zur Seite lebensgroß und beinahe vollplastisch heften sich die beiden Johannes an den Plafond. Der Täufer wiederholt einen damals Donatello zugeschriebenen Vorgänger im lateranischen Baptisterium. Völlig gemäß der auf Selbsterklärendes zielenden tridentinischen Didaxe präsentiert sich hier Christus Salvator im Zentrum von Glauben, Kirche und Basilika. Ihm zunächst die beiden Apostelfürsten. Petrus, der Urpapst und Paulus, der Erz-Missionar. Die Anfechtungen durch die Reformation wurden von den Päpsten mit Propaganda für das Petrusamt erwidert. Gegenreformation wie auch die Hinführung der Neuen Welt zum Katholizismus forderten eine missionarische Kirche.
Bildnisse der Apostelfürsten veranschaulichten dies in steter und legitimierender Wiederholung. Mag immer die Decke des Querhauses die Aufteilung in drei zentrale Rechtecke und begleitende Felder von der des Mittelschiffs übernehmen, sie beabsichtigt anderes. Zwar verschafft sich in der Nave Clementina des Papstes Wappen gleich zwiefach Geltung, doch das Zentrum verbildlicht den Salvator samt den mit der Lateranbasilika verbundenen Heiligen. Hingegen stellt sich im Mittelschiff allererst Heraldik zur Schau. Inmitten das Wappen Pius IV. – eines, wenn auch aus einer der Florentiner nicht verwandten Mailänder Familie stammend, so doch die berühmten fünf Pillen im Schild führenden – Medici, der den Auftrag zum 1562 begonnenen Plafond erteilte. Gen Papstaltar das seines Nachfolgers Pius V., unter dem die Decke 1567 fertiggestellt wurde. Zum Eingang hin das Pius VI., der sie im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts sanieren ließ. Hierbei ersetzten die Wappen der beiden Nachfolger Pius IV. portalwärts jenes der Lateranbasilika selbst, in Richtung auf den Altar das SPQR der Stadt Rom. Unerachtet des 1563 abgeschlossenen Trienter Konzils, formuliert die Decke des Mittelschiffs keine gegenreformatorischen Devisen. Pius IV. hatte gleich zu Beginn seines Pontifikats in einer Rede dargetan, worauf es ihm ankam: den angefochtenen Primat der Lateranbasilika gegenüber dem Petersdom zu unterstreichen und dieses Ziels halber seine Bischofskirche durch Kunst aufzuwerten.
Es galt daher den damals prominentesten Plafond der vier Papstbasiliken zu übertreffen, den um einige Jahrzehnte früheren in S. Maria Maggiore. Daniele da Volterra, jener Michelangelo-Adept, der auf Pius IV. Geheiß die vermeintlichen Anstößigkeiten des Jüngsten Gerichts in der Sixtina bedeckte und daher Spott als „Braghettone“ (Hosenmaler) leiden musste – lieferte den klug disponierten Entwurf. Der in Sachen hölzerner Flachdecken für Roms Gotteshäuser erfahrene Flaminio Boulanger, ein Franzose, führte ihn aus. Über dem Wappen des Medici-Papstes finden sich in dessen L-gestalter Rahmung die Reliefbüsten Peters und Pauls im Profil samt zugehöriger Requisiten vom Hahn über die Lichterscheinung vor Damaskus bis zu den Marterwerkzeugen. Während sie auf dieser Position die Dignität des Papstwappens steigern sollen, zitiert die Decke des Querhauses die Büsten als Zeugen der Erscheinung des volto santo. Der Blick fokussiert sich nicht mehr auf seinen Stellvertreter auf Erden, am Plafond der Nave Clementina gilt der vornehmste Platz dem Salvator selbst.
Der lehrhaften Evidenz ordnen die sich über die Nebenfelder verteilten liturgischen Geräte und Marterwerkzeuge vollkommen unter. In den analogen Zonen der Mittelschiffdecke hingegen vereint sich Folter- und Hinrichtungsinstrumentarium samt Weihwasserkesseln, Weihrauchfässern, Bischofsstäben, Vortragekreuzen und jenem giftgefüllten Kelch (kenntlich an den daraus hervorzüngelnden Schlangen), den der Dianapriester zu Ephesus Aristodemus dem Apostel Johannes reichte, ohne ihm etwas anhaben zu können, auf das Anmutigste mit jenen Grotesk-Ornamenten, wie sie Raffael bei der Erkundung von Neros Goldenem Haus entdeckt hatte.

Mag immer die Gegenreformation im Bildprogramm der Mittelschiffdecke noch nicht durchschlagen, allein das Vorhaben, die Lateranbasilika als dem Petersdom übergeordnet zu betonen und auszuzeichnen, bekundet das Trachten nach kirchlicher Erneuerung. Mehr noch als das Apostelgrab auf dem Vatikanhügel begründet des Pontifex Maximus‘ Bischofskirche im Lateran dessen Rang. Hier erschien beim Weihegottesdienst der Salvator im höchsteigenen Bild, hier berief in der Konstantinischen Schenkung der römische Kaiser Christi Statthalter auf Erden zum auch weltlichen Herrscher. Dass die vorgeblich von Konstantin ausgestellte Urkunde längst als Fälschung entlarvt war, schien ignorabel. Das Bildprogramm der Fresken im Querhaus jedenfalls will von Schwindel nichts wissen. Gegen die Beweislage nimmt es Konstantins vorgebliche Schenkung für bare Münze.
Sei dem, wie ihm sei. Weder die Bild-Belehrungen auf der Schwundstufe der Renaissance in der Nave Clementina noch Borrominis freilich beinahe bezwingend pathetische Rhetorik vermögen über die Anfechtungen des Papsttums und der römischen Kirche durch Luther und später den Dreißigjährigen Krieg hinwegzutäuschen. Gewiss überragt der Sakramentsaltar in seiner architektonisch strengen und gleichzeitig suggestiven Ausrichtung auf das Abendmahl die bloß lehrhafte Kunst im Nachgang des Trienter Konzils wie den benachbarten Wandfresken bei weitem. Allein, dass dem Schauplatz für die Transsubstantiation von Brot und Wein ein konfessionelle Versöhnung stiftender – gleichrangiger – Ort für das Wort und seine Auslegung zugesellt werde, bleibt bloßer Wunsch.
Mehr Bischofs- als Papstkirche
Letztlich unaufhaltsam lief der Petersdom der Lateranbasilika wenn schon nicht die kirchenrechtliche Vorrangstellung, so doch die von der Christenheit wie auch Anders- und Nichtglaubenden wahrgenommene Bedeutung ab. Der Gründe sind etliche, ein wesentlicher dürfte die Anziehungskraft des Apostelgrabs sein. Keine Frage, dem Baugrund der Lateranbasilika eignet geringere religiöse Aufladung. Verglichen mit der Petersgruft wog die Hauskirche der Fausta zu leicht. Ferner sind Architektur und Ausstattung von Bedeutung. Allererst des Petersdomes Abriss und Neubau. Mannigfacher Metamorphosen der anfänglichen Planung unerachtet, nehmen Gläubige wie auch Touristinnen und Touristen – anders als mit Kunstgeschichte Befasste – draußen vor und im Gotteshaus über dem Grab des Chefapostels und Urpapstes einen Bau aus einem Guss wahr. Beste Werbung für Anspruch und Auftreten der katholischen Kirche und ihres Vorstehers. Hingegen registrieren Besuchende der Lateranbasilika unerachtet einzelner Geniestreiche wie denen Olivieris und Borrominis das baukünstlerische Konglomerat.
Arg vieles zeigt sich unvermittelt. Für die Kunstgeschichte zweifellos voller Reize und Appelle zu weiterer Forschung, während Pilgernde neben Hochachtung das Uneinheitliche empfinden. Gleichviel, die Ortskirche hat sich pragmatisch darin eingerichtet. So ist und bleibt denn die Lateranbasilika die Kathedrale des Bischofs von Rom. Persönlich anwesend ist er selten. Seine Vorgänger aus Spätantike, Mittelalter und vereinzelt noch der Renaissance präsentierten sich hier vor allem als Vorsteher der Weltkirche. Tempi passati. Meist geschieht das nun im Petersdom. Zu wünschen wäre, dem gegenwärtigen Amtsinhaber gelänge beim Gottesdienst in der Lateranbasilika die Einübung in und die Gewöhnung an seine Berufung zum Bischof von Rom. Einem Bischof unter Bischöfen.