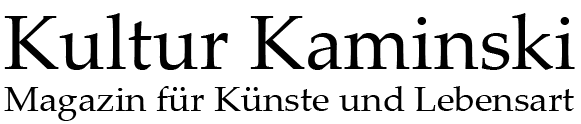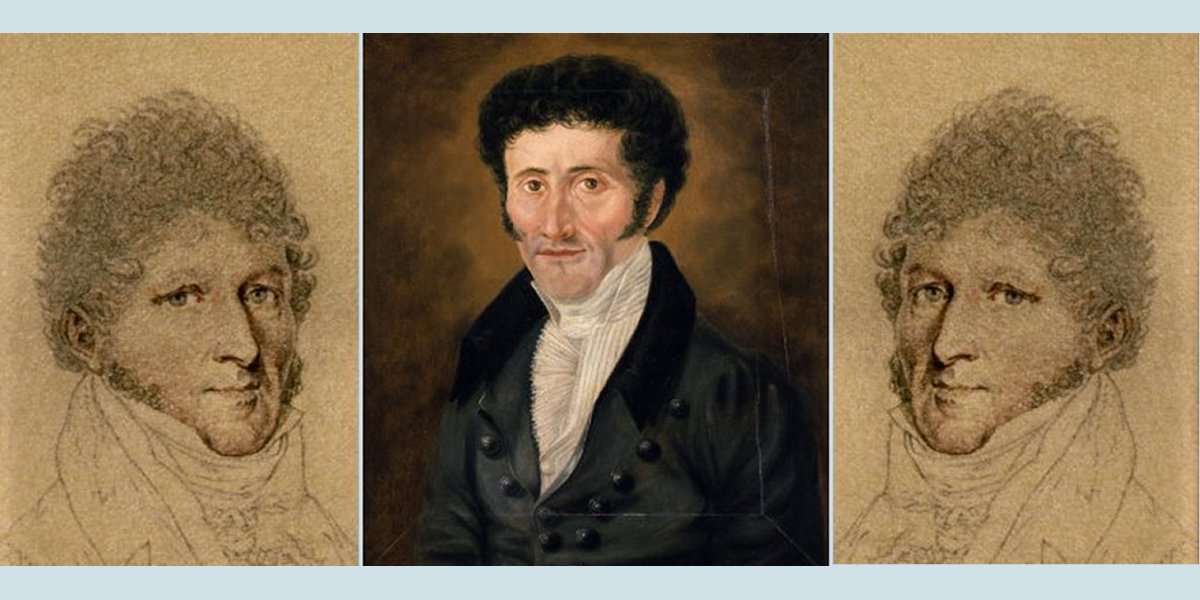Armeleuteviertel und Vorhof zum Ruhm
Michael Kaminski
Karfreitag. Die Familie wich vor dem scandalon crucis ins Dortmunder Opernhaus aus. Nicht aber stand dort „Parsifal“ oder vergleichbar Erhebendes auf dem Spielplan, vielmehr „La Bohème“. Ansonsten Zugstück, war der Saal nur zur Hälfte besetzt. Das Werk passt nicht zum Charakter des Feiertags. Wenn im Momus-Bild Weihnachten auf die Bühne kommt und damit statt Kreuzigung und Tod der Lebensbeginn des Religionsstifters, so war das an diesem Tag unter theologischem Gesichtspunkt sicher fehl am Platz. Mochte immer der Heilige Abend in „La Bohème“ nurmehr Anlass zu ganz und gar weltlichem Treiben bieten. Weihnachten ist schon in Puccinis Werk ebenso säkularisiert wie heutigentags. Auch deshalb verstehen wir seine Oper noch immer so gut. Der Siebtklässler war schwer beeindruckt. Wesentlich dazu bei trug die Cinemascope-Bühne von Hans Schavernoch, auf der sich das Quartier Latin panoramatisch ausbreitete.
Hausherr und Regisseur Paul Hager erzählte strikt am Werk entlang. So, wie er das bereits -mit Pavarotti als Rodolfo – in San Francisco getan hatte. Doch hatte das Dortmunder Ensemble sicher eines nicht aufzubieten, Italianità. Immerhin gab die später auf eine Gesangsprofessur mit ersprießlicher Studierendenschar gewechselte Verena Schweizer eine ins Gemüt greifende Mimi. Rodolfo erwies sich als vokal tragischer Fall, ich verschweige seinen Namen. Quetschend und pressend drückte er seinen Tenor durch die Mittellage, um sich in der Höhe voll Strahlkraft zu entfalten. Sein „Che gelida manina“ mit famosem hohen C müsste noch irgendwo unter den Konserven im WDR-Rundfunkarchiv zu finden sein. Der spätere internationale Alberich vom Dienst Franz Josef Kapellmann war Marcello, der dann vor allem als TV-Moderator hervorgetretene Günter Wewel Colline. Unter einem nachgeordneten Kapellmeister ließ sich des Hauses Orchester achtbar vernehmen. Ich zählte zwölf oder dreizehn Jahre. Heftiger als die Liebesgeschichte zwischen Mimi und Rodolfo befeuerten mich Musetta und Marcello.
Die Zuweilen-Kokotte – ich weiß nicht sicher, ob die Schweizerin Francesca della Porta sie verkörperte – war mir näher als die Stickerin, der eifersüchtige Maler schien mir verwandter als der poetische Rodolfo. Doch eher als einzelne Figuren nahm den jungen Menschen das Künstlerfluidum ein, die Sorglosigkeit um Broterwerb und leere Kassen, die Spontaneität und Unbekümmertheit. Musettas valse lento betörte ihn, überhaupt die ganze Struktur des Momus-Bildes. Hingerissen gab er sich dem Übergang von Musettas Walzer in die Eifersuchtsszene mit Marcello samt Ensemble und von hier in den ironisch-triumphalen Schlussmarsch hin. Rodolfos und Marcellos Duett im vierten Bild drang ihm in die Seele. Der Schüler wusste etwas von Urlaubslieben, denen er nachtrauerte. Dass Mimi starb, zählte für ihn schlicht zur Gattung Oper. Vor kurzem hatte er in „Hoffmanns Erzählungen“ Antonia hinscheiden hören und sehen.
Mimis Muff
Etliche Jahre später, zweiter Weihnachtsabend: Die Frau, mit der ich die „Bohème“ besuchte, fühlte sich vor allem durch das ständige Frieren Mimis und der vier Freunde vom Stück berührt. Aus der Begleiterin wurde keine Gefährtin, doch ließ mich ihre Beobachtung über die Ursache für die winterliche Unbehaglichkeit sinnieren, Armut. Längst registrierte ich bei Mimis Sterben und Tod nicht mehr das bloß gattungstypische Erfordernis. Ich empfand Beklemmung und Trauer. Wie anders dachte ich nun vom „eiskalten Händchen“ und Rodolfos Weihnachtsgeschenk, dem Muff. Jene Inszenierungen packen mich bis heute, in denen er einmal nicht sentimentales Requisit ist, sondern tatsächlicher und letzter Trost für die Moribunde. Denn mehr noch, als Rodolfo es vermag, wärmt Mimis fröstelnde Hände der Muff. Opfer der Tuberkelbazillen wird die junge Frau aus der städtischen Unterschicht, weil sie die Forderungen der obwaltenden kleinbürgerlichen Moral anerkennt.
Als Stickerin möchte sie gelten, ihr Geld durch gesellschaftlich als ehrbar abgesegneten Erwerb verdienen. Moral aber kostet. Für Mimi ist der Preis zu hoch. Im Widerspruch zu ihren dem Kleinbürgertum entliehenen Vorstellungen, verschafft sie sich ab und an ein Zubrot durch Gelegenheitsprostitution. Es reicht dennoch nicht zum Überleben. Kleinbürgermoral erübrigt für die arbeitsame und tugendwillige Stickerin letztlich nur eines, den Tod. Mimis Leben verläuft auf der Horizontalen der Armut. Im Elend geboren, stirbt sie im Elend. Hingegen spielt Musetta nach Regeln jenseits bürgerlicher Wohlanständigkeit. Davon, dass sie je einer unter bourgeoisem Gesichtspunkt „ehrbaren“ Profession nachgegangen sei, ist nichts zu erfahren. Lebenstüchtig richtet sie sich in einer Zwischenwelt ein oder – wenn man den Begriff vorurteilsfrei fasst – demimonde. Mit Gelegenheitsprostitution gibt sie sich nicht ab. Musetta kehrt offen die hauptberufliche Maitresse heraus, wenn auch keine ersten Ranges wie die Violetta der „Traviata“. Ihre Mittel sind nicht die kultivierten, auf Angehörige der männlichen Oberschicht zielende. Musetta stilisiert sich vielmehr zum launenhaft-raffiniert durchtriebenen Biest; sie spielt ihren Part vorzüglich.
Nie bestand für mich ein Zweifel, dass sie eines Tages eine ordentliche Partie machen würde. Gut möglich, sie würde Alcindoro heiraten, mindestens aber jemanden seinesgleichen. In Henri Murgers Roman „Scénes de la vie de bohème“, an dem sich Puccini für seine Oper inspirierte, ehelicht sie einen Postmeister. Zuvor aber verbringt sie zum Abschied aus dem Leben, das sie nun hinter sich lässt, eine für beide schale letzte Nacht mit dem Maler. Gleichviel, ihr gelingt der Aufstieg ins Kleinbürgertum. So formulieren denn die beiden Frauenfiguren in Puccinis Oper ein doppeltes Paradox: Die regelkonforme Mimi scheitert an der kleinbürgerlichen Utopie, während der demonstrativ unbürgerlichen Musetta der Aufstieg in Richtung Bourgeosie gelingt. Verdientermaßen. Denn wie kapriziös auch immer sich die Kokotte gibt, wenn es darauf ankommt, erweist sie sich als unverbildet, mitfühlend und tatkräftig hilfsbereit. An Mimis Kranken- und Sterbelager opfert die der Profession halber auf blendende Erscheinung Angewiesene ihren Schmuck zur Beschaffung von Medikamenten.
Fesche Garderobe und güldene Kleinode zählen zu ihrer Berufskleidung. Sie zu erwerben, bedarf es harter Arbeit. Der drangegebene Schmuck ist nicht aus der Portokasse zu ersetzen. Musetta teilt keinesfalls ihren Überfluss, sie schenkt aus dem Mangel. Verdingt sie sich zwischenhin in der Kneipe an der Barrière d’enfer, findet sie sich haarscharf auf der Kante zum gesellschaftlichen Absturz.
Armut ungleich Armut
Obschon am nämlichen Ort Marcello eines seiner ambitionierten Historiengemälde zum Wirtshausschild umfirmieren muss, seine Armut ist nicht die Musettas. Ebenso wenig, wie Rodolfos Mittellosigkeit die Mimis ist. Nämliches gilt für die materiellen Entbehrungen der beiden anderen Freunde. Zwar setzen den Viert in der zugigen Mansarde Frost samt anderer Unbilden der Witterung zu und Hunger ist kein steter, aber häufiger Gast, doch zeigt sich das Quartett in der Zuversicht auf baldigen Durchbruch in den jeweiligen Metiers vereint. Für die Freunde ist das Bohèmedasein die Vorstufe des Erfolgs. Jedenfalls eingedenk der „Scénes de la vie de la bohème“. Wie das Schlusskapitel des Romans bestätigt, aus dem sich die einstigen Nonkonformisten als behaglich etablierte Bourgeois verabschieden, schreibt sich Rodolfo dem Erfolgsdramatiker entgegen, Marcellos Gemälde werden den Salon zieren, Schaunhards Lieder avancieren zu den Favoriten der musikalischen Abendgesellschaften, Colline reüssiert zum intellektuellen Aushängeschild jeden Empfangs.

Verfeuert der frostgeplagte Rodolfo daher sein Drama, so wird ihn die Liebe zu einer wirkmächtigeren Version begeistern. Degradiert Marcello sein Historiengemälde zum Firmenschild, dann wird seine sprichwörtliche Muse – eben Musetta, Diminutiv für die Göttin der Künste und auch im Französischen (Musette) nicht allein Dudelsack – ihn zu einem nächsten beflügeln. Sicher, im Gegensatz zum Roman lässt die Oper die Zukunft der vier Freunde offen. Denkbar sind Situationen materieller Ausweglosigkeit. Und ja, nicht jeder Künstler und Intellektuelle des Quartier Latin fand sich auf schließlicher Erfolgsbahn. Manch‘ einer scheiterte gänzlich. Vor allem – vermute ich – die Einzelgänger und Eigenbrötler. Netzwerken war geboten. Hoffnungsvoll stimmt deshalb, wie sich die vier Freunde in das Überleben sichernder Weise ergänzen.
Rodolfo streicht früher oder später ein Honorar für seine journalistische Brotschreiberei ein, Marcello verkauft ein Bild – und sei es ein zum Ladenschild umgepinseltes, Schaunhard erteilt Tier und womöglich gar Mensch Gesangsunterricht und selbst Colline wird mutmaßlich ab und an ein Salär zuteil. WG wie sie im Buch steht halt. Jeder springt für jeden ein: einer für alle, alle für einen. Gleich Murgers Roman ist Puccinis Oper eine Hommage auf die Freundschaft. Eine der gewinnendsten und bedeutendsten. Zwar waltet kein Heroismus wie in Schillers „Bürgschaft“ und seinem oder Verdis „Don Carlos“, doch im Einstehen füreinander einer allen Befreundeten zu wünschende Gut- und Großherzigkeit. Überdies durchweht der Geist von „Les Trois Mousquetaires“ die Wohngemeinschaft. Der Roman von Dumas pere war 1844 erschienen, der Murgers kam in mehreren Fortsetzungen während der zweiten Hälfte des Jahrzehnts heraus.
Wohlbehagen und Not
Mindestens einer der mir bekannten Kollegen würde meiner optimistisch grundierten Sicht auf das Leben der Bohemiens widersprechen: Ein zur Vernichtung seines Dramas genötigter Schriftsteller und ein sein Gemälde zur Reklame umfunktionierender Maler seien ihrer Berufung entfremdet. Nicht minder ein Musiker, der einem Papageien Gesangsstunden erteilt. Gewiss fordern die Lizenzen, derer sich die Bohemiens bedienen, ihren Preis. Doch niemals in ihrem Leben werden die Vier unabhängiger von gesellschaftlichen Forderungen und Zwängen gewesen sein als im Quartier Latin. Freiheit dieser Art meinte Murger, meinte die Trias aus Puccini und seinen Librettisten Giacosa und Illica. Doch, ob in Paris oder Mailand, sie ließen die Bohème-Epoche ihres Lebens hinter sich, um auf die Erfolgsspur zu wechseln. Cum grano salis darf die Zeit der vier Bohemiens im Quartier Latin mit den Studien- und ersten Berufsjahren gleichgesetzt werden. Zu wissendem Lächeln und sonstigem Behagen bei Lesenden und Publikum in den Ohren- und Opernsesseln. Denn nicht Rodolfo, Marcello, Schaunhard und Colline landen im Elend. Weder Murger, noch Giacosa und Illica, geschweige Puccini. Mimi bleibt auf der Strecke. Und mit ihr so manche Unterschichtig-Prekäre.
Fortsetzung folgt