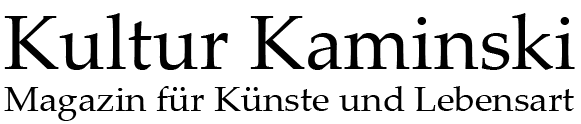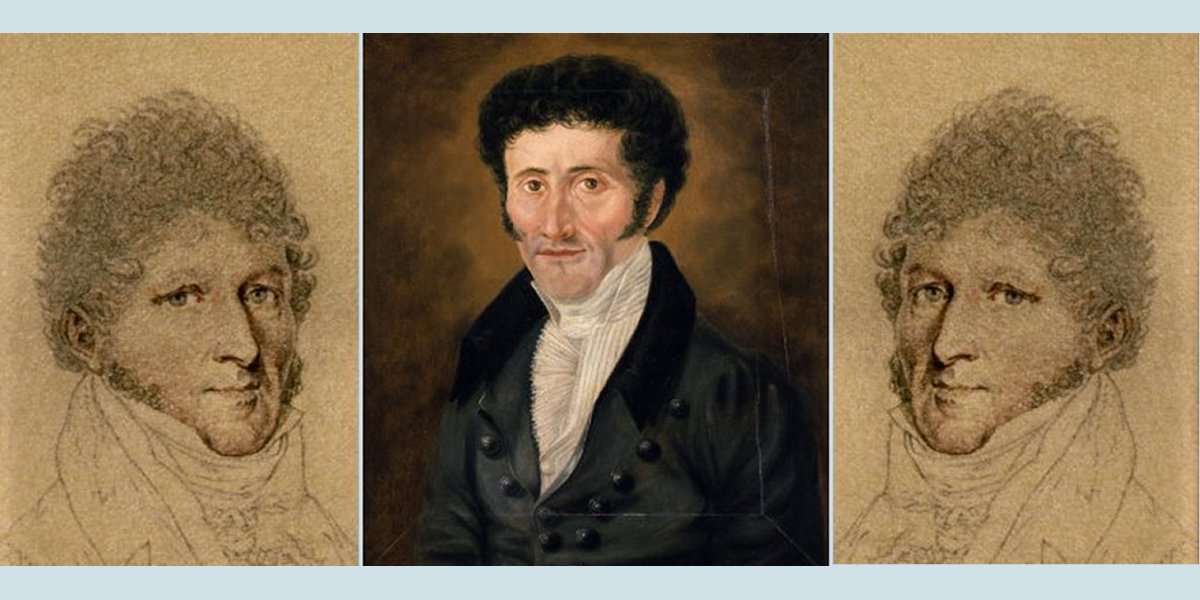rechtes Bild: Paris – Jacques Offenbach von Wowo2008 Lizenz: CC BY-SA 4.0
Noch immer suchen>Les contes d’Hoffmann< nach
verbindlicher Gestalt.
Der Komponist starb, bevor sein opus summum vollendet war. Offenbach hinterließ stapelweise Notenblätter, die von bloßen Skizzen bis zu detailliert Ausformuliertem reichen. In welcher Gestalt aber das Werk am Ende das Rampenlicht hätte erblicken sollen, bleibt teils vagen Vorstellungen überlassen. Die Versionen von Offenbachs >Les contes d’Hoffmann< sind daher Legion. Gegenwärtig stellt jedes Haus aus der kaum überschaubaren Materialfülle, die Michael Kaye und Jean-Christophe Keck in der bei Schott erschienenen >Kritischen Ausgabe< zusammengetragenen haben, eine eigene Variante zusammen. Das Brüsseler >La Monnaie<, in dessen weit zurückreichenden Annalen für das Jahr 1887 eine Aufführung auf Basis einer damals frisch erschienen Ausgabe des Werks steht, die aus der Rückschau nur als skurril bezeichnet werden kann, wartet gegenwärtig mit einer dramaturgisch überzeugenden Version auf. Für mich Anlass, um meine Erfahrungen mit >Les contes d’Hoffmann< zu resümieren. Sie waren mein erstes Opernerlebnis.
Landauf landab wurde damals noch die Guiraudfassung gespielt, während meines Studiums dann die von Fritz Oeser. Diese von Fall zu Fall mit oder ohne Spiegel-/Diamantenarie und sogenanntem Septett. Nicht wenigen fiel die Trennung von der gewohnten Werkgestalt schwer. Das deutsche Publikum hatte sie sich förmlich anverwandelt. Die Frau des Intendanten eines größeren Hauses bekannte damals meinem Vater, wie sehr sie die Guiraud-Fassung vermisse. Im Geheimen nur und eher verschämt, gestand ich mir, sie zu verstehen. Guiraud, ein Komponist von Graden, hatte das Werk konsistent und schlüssig eingerichtet. Sein Verdienst ist ebenso am Tag wie das Nikolaij Rimskij-Korsakows um die Instrumentation des >Boris<. Die Zeit ist darüber hinweg gegangen, doch ohne die Anstrengungen der beiden Komponisten hätten weder >Les contes d’Hoffmann< noch Mussorgskijs chef de oevre beizeiten ins Repertoire gefunden.

Freilich lässt sich der schier unabsehbaren Menge von Notenkonvoluten
und der Qual der Wahl halber mit der Ausgabe von Kaye und Keck eine Menge Langeweile
produzieren. Beinahe verging mir Hören und Sehen, als ich vor einigen Jahren in
einem völlig überdehnten fünften Akt mit endloser Apotheose, der offenbar nicht
dramaturgischen Absichten folgte, sondern darauf aus war, das Material in
möglichster Vollständigkeit zu präsentieren, eingeschlafen wäre, hätte nicht
das durchgesessene Polster meines Platzes dies verhindert. Denn die
Offenbachschen Autographen sind zwar sämtlich
musiktheatergeschichtlich und editorisch belangvoll, ebenso klar aber
ist, dass der Komponist vieles davon für die verbindliche Gestalt seines Werkes
verworfen haben würde.
Was im Fall der >contes< von Dramaturgen und
Dirigenten verlangt wird, geht daher weit über das gewöhnliche
Anforderungsprofil hinaus. Hier stehen nicht etwelche Striche zur Profilierung
des Stücks und Rücksichtnahme auf die Verhältnisse vor Ort zur Debatte. Die
Quellenlage gebietet vor allem im Venedigakt und final, das Werk aus der
vorhandenen Vielfalt kongenial erst zu erschaffen. Ich traue den Opernhäusern
eine Menge zu. Doch, dass ein jedes Talente für die heikle Aufgabe vorhält,
diese Zuversicht teile ich nicht.
So hoffe ich denn, mit der Zeit werde sich eine überzeugende
Werkgestalt herausbilden, die dann – jedenfalls im Wesentlichen – von den
meisten Häusern übernommen wird. Mochte ich mir früher einmal nicht vorstellen,
auf Spiegel-/Diamantenarie und Septett zu verzichten, inzwischen bin ich
gewiss, dass es auf diese späteren Zutaten nicht ankommt, wenn nur die
dargebotene Version zu packen vermag.
Eher frage ich mich, ob die wiederentdeckte Arie für
Giulietta, zu deren Würdigung ich ernsthaft entschlossen war, sich bei
nüchternerer Betrachtung nicht als der
Rolle wenig angemessenes recht belangloses Couplet ohne für das Werk
entscheidende Bedeutung erweist. Mehr noch wundert mich der Verzicht auf die
hochkarätige Musik von Coppélius‘ >J’ai de yeux<. Die Rückübertragung auf
den ursprünglich für Dapertutto vorgesehenen Text, könnte – im Gegensatz zur Arie Giuliettas – den
Venedigakt substantiell bereichern. Der Versuch jedenfalls würde nicht schaden.
Mag aber sein, es fehlt am Sensibilität
und Beherztheit – wie weiland Guiraud – vereinbarenden Komponisten, dem gelingt, aus Kayes
und Kecks editorischem Massiv ein Werk zu erwecken, das Offenbach als das Seine
anerkannt hätte. Ein Irrealis, ich weiß. Doch ein notwendiger. Kunst verlangt
danach
Die vom Verlag als PDF-Datei zur Verfügung gestellte Einleitung zur >Kritischen Ausgabe< von Kaye und Keck bringt Ordnung ins Materialchaos.