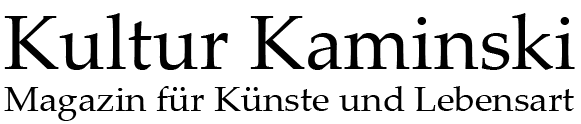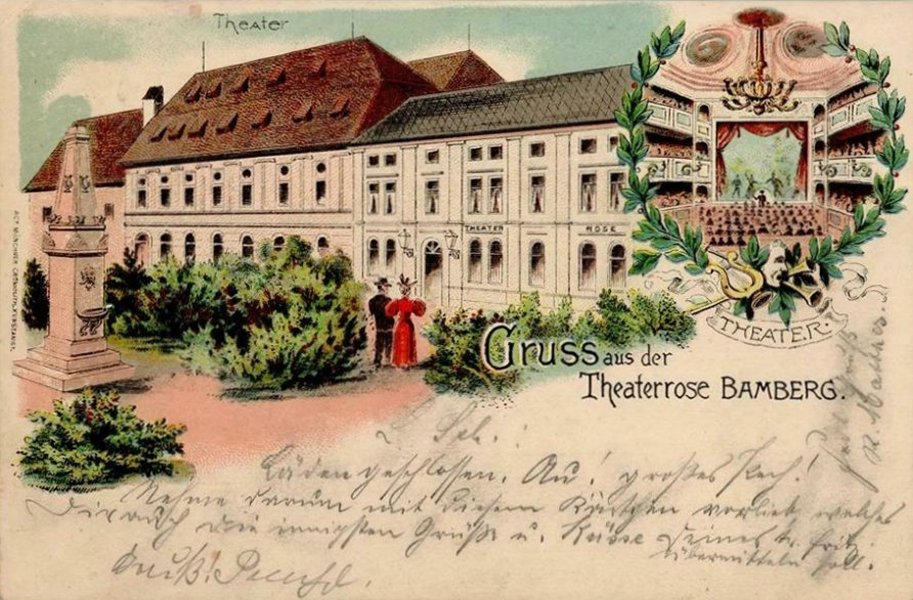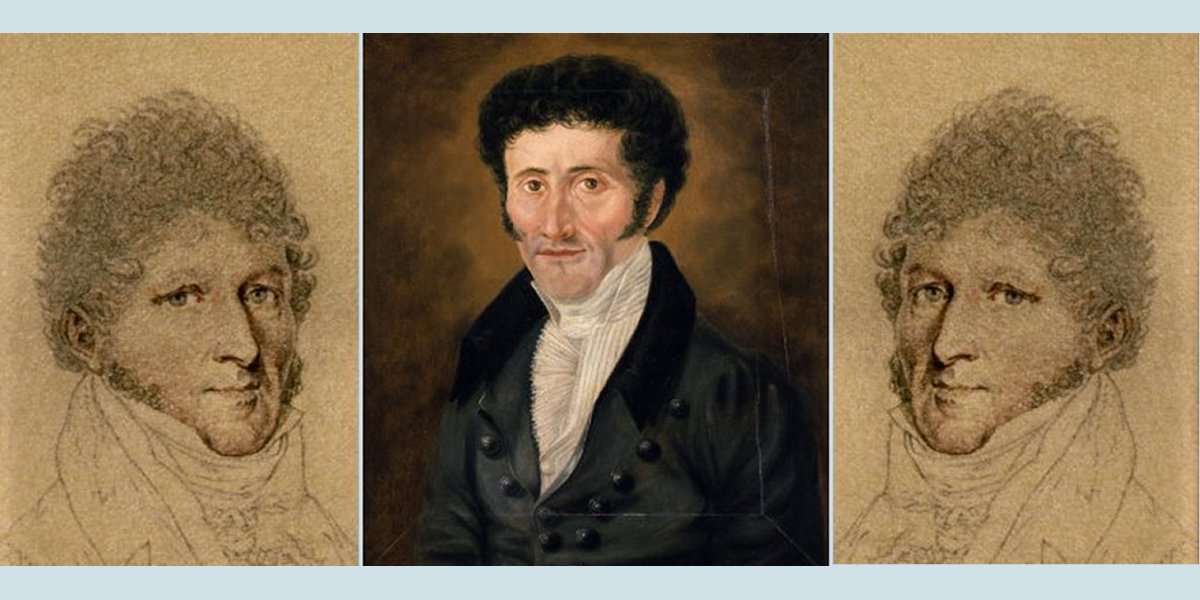Vierung mit Papstaltar. Foto Richard Mayer
Im Zentrum der Papstkirche
Noch gegen Ende des 15. Jahrhunderts lief die konstantinische Stützenreihung des Mittelschiffs bis unmittelbar vor die Apsis durch. Erst 1492 wurde – getragen von hierfür wiederverwendeten korinthischen Säulen – vor dem Papstaltar ein Triumphbogen eingezogen. Seine heutige Gestalt erhielt er im Zug der Spätrenaissance-Umgestaltung des Querhauses in den letzten Jahren des 16. Jahrhunderts. Erst jetzt ergab sich eine tatsächliche Vierung. Seither präsentiert sich der Triumphbogen in Richtung auf den Chor von einem Pendant hinterfangen. Mit Ausnahme der korinthischen Kapitelle bestimmt Zurückhaltung die Formen. Die Halbkreisbögen zeigen sich im Wesentlichen durch schlichte Profilleisten gegliedert. Nur solche Einfachheit und Größe erlauben, vor der optischen Reizüberflutung durch Mittelschiff, Ziborium über dem Papstaltar und Apsis zu bestehen.
Der architektonische Mischcharakter des Papstaltars
Obschon in der Vierung gelegen, profitiert der Papstaltar von Borrominis lichter Durchfensterung. Vor allem, weil das liturgische Zentrum der Bischofskirche des Kirchenoberhaupts seine Position nicht in der Vierungsmitte einnimmt, vielmehr rückt es in Richtung Hauptschiff vor. Vollständig von Marmor umgeben, birgt der schlichte Papstaltar Kostbares: Holzbretter; die Platte jenes Tisches, an dem der hl. Petrus und seine Nachfolger bis hin zu Papst Silvester Eucharistie gefeiert haben sollen. Baldachingleich erhebt sich darüber das in seiner Art einzige Ziborium aus den sechziger Jahren des vierzehnten Jahrhunderts. Plan und skulpturale Arbeiten lieferte Giovanni di Stefano. Gotisch schlank in vielen Details, nimmt es sich im Ganzen eher kastenförmig aus. Vier stämmige korinthische Säulen tragen den Aufbau.

Bama da Siena. Gemälde auf der Mittelschiffseite. Foto Sailko
Die Ecken der unteren Zone werden von Steinfiguren und auf jeder Seite drei Gemälden Bama da Sienas eingenommen. In Richtung Mittelschiff Christus am Kreuz, ihm zur Seite Mutter und Lieblingsjünger. Auf dem linken Bild begegnen Jakobus und Paulus, auf dem rechten Petrus und Andreas. Zum Chor hin gebietet eine Marienkrönung durch den Sohn über das Zentrum, zur Linken flankiert durch die Verkündigung, zur Rechten durch die hl. Katharina. Zwar hat Antoniazzo Romano bei seiner Restaurierung ersichtlich den Geist der Frührenaissance eingebracht wie ferner eine weitere Überholung Mitte des 19. Jahrhunderts nicht eben des Originals Bedeutung herausstreicht. Für die spricht, wie den fragwürdigen Restaurierungen und den leicht verwaschenen Formen in ihrem Gefolge zutrotz noch immer hochklassiges Trecento durchscheint.

Barma da Siena. Gemälde auf der Chorseite. Foto Sailko
Oberhalb des Bilderstreifens rahmen schlanke Pfeiler einen quadratischen Käfig-Kubus, der als Transportkiste einem Leuen genug Raum böte. Den vergoldeten Gitterstäben eignet die durchlässige Anmut von Schnürvorhängen. Das Innere wird von einem Kreuzrippengewölbe überfangen, aus dessen tiefblau grundierten Kappen güldene Sterne auf die Kopfreliquiare Petri et Pauli niederfunkeln. Der zierliche Großkäfig fungiert als Ostensorium, Schaubehälter für die Apostelhäupter. Diese selbst wurden bis zum Diktatfrieden von Tolentino im Jahr 1797 in edelmetallenen Bildnissen aus den Entstehungsjahren des Ziboriums aufbewahrt. Napoleons Italienarmee hatte den Kirchenstaat in die Knie gezwungen. Zur Kontributionszahlung an die französischen Sieger, mussten Kunstschätze herhalten. Gold- und Silberschmiedearbeiten wurden kurzerhand eingeschmolzen. Um schmaler Galgenfrist willen. Im Jahr darauf besetzten die Franzosen Rom. Heute zeigen sich die Schädel in Repliken wohl nach Kupferstichvorlagen geborgen. Macht aber wenig. Ihrer Feingliedrigkeit unerachtet, verhindern die Gitterstäbe ohnehin die genaue Inaugenscheinnahme. Das Reliquienostensorium wird durch einen von einem Halbkreisbogen gerahmten Fünfpass geschlossen. In den Feldern vergoldete, wie die Gitterstäbe halbe Transparenz gewährende, delikate – auf Ajour-Fassungen für Edelsteine anspielende – Schmiedeornamentik. Halbkreis samt mäßig hoher Wimperg darüber werden durch schlanke Fialen flankiert. Steil wie die Cestiuspyramide hingegen steigt das Dach an. Kaum noch scheint es steinern. Güldene Ornamentik auf grauem Grund gemahnt vielmehr an kostbarsten Seidenbezug.

Ziborium. Blick ins Reliquienostensorium. Foto Antoine Tavenaux
Solche Transzendierung von Materie trägt zum Einnehmenden des Ziboriums wesentlich bei. Unter negativem Vorzeichen hingegen dünkt es eine funktionale Chimäre. Während sich im Erdgeschoss die Transsubstantiation vollzieht, amten alles andere als verhältnismäßig zum hierdurch beinahe degradierten Geschehen unter ihnen in höheren Sphären Petrus und Paulus. Milderung der Hoffart erwächst aus der Baugestalt des Ziboriums. Ob lediglich oder immerhin, bleibt dem Urteil der jeweilig Betrachtenden anheimgestellt. Jedenfalls würde der Zug französischer Gotik allein in die Höhe die fragwürdige Hierarchie schier unerträglich betonen. Italienische Gotik hingegen baut bei allem Ragen durchaus auf das Gelagerte. So formiert denn das Säulengeviert des Ziboriums ein Quadrat. Gleicherweise Vierkantpfeiler und Gitterstäbe des Reliquienostensoriums. Hinzu kommt der den Reliqienschaukasten vollendende Halbkreis- statt französisch-gotischem Spitzbogen. Solche Tendenz zum Ausgleich zwischen Vertikalität und Horizontalität hilft die theologisch abstruse, doch der päpstlichen Propaganda willfahrende Rangordnung der über der Eucharistie situierten Apostel zu ästhetisieren. Wohin die ausgeprägte Freude am Schauen spätmittelalterliche Menschen hauptsächlich blicken ließ, bleibt ein Rätsel. Dass sich die Aufmerksamkeit allererst auf die Eucharistie richtete, wie das bei heutigen Gottesdienstbesuchern der Fall ist, darf bezweifelt werden. Petri et Pauli kostbare Häupter boten mindestens gleichen Schlüsselreiz.
Das Ziborium als Zeichen der Hoffnung
Solchen Einwandes unerachtet, weist sich im Ziborium der Lateranbasilika die gebaute Hoffnung auf das Ende der Umsiedlung der Päpste nach Avignon und ihre dauerhafte Rückkehr in die Ewige Stadt. Auftraggeber war Papst Urban V., den 1364 Kaiser Karl IV. im Verein mit Boccaccio als Gesandtem von Florenz, Petrarca und der hl. Brigitta von Schweden in der Stadt an der Côte d’Azur aufgesucht hatten, um ihn zur Reise an die Gräber der Apostelfürsten zu bewegen. Drei Jahre darauf folgte der Papst ihren Bitten. Urban V. begann Renovierungsarbeiten in der vernachlässigten Stadt. Zum Vorteil auch der Lateranbasilika. Kaiser Karl IV. fand sich ein, um seine Gemahlin Elisabeth von Pommern vom Papst in der Peterskirche zur Kaiserin krönen zu lassen. Das auf Frankreich ausgerichteten Papsttum fasste ergänzend nun wieder das Heilige Römische Reich ins Auge. König Karl V. von Frankreich sann darauf, weiterhin im Spiel zu bleiben, indem er sowohl für den Bau des Ziboriums als auch die Reliquiare der Apostelfürsten spendete. Zu allem Überfluss wartete der byzantinische Kaiser Johannes V. Palaiologos dem Kirchenoberhaupt auf. Der Palaiologe suchte Unterstützung im Widerstand gegen die vordringenden Osmanen. Die Wiedervereinigung von Ost- und Westkirche schien für Papst und oströmischen Herrscher nahe. Das letztliche Scheitern des Byzantiners ging auf das Konto der Venezianer, die den Kaiser auf seiner Rückreise in Schuldhaft nahmen. Doch waren Urbans V. Tage in Rom gezählt. Die übermächtige französische Kardinalsfraktion drängte auf des Papstes Rückkehr nach Avignon. Den Drohungen der hl. Brigitta und den Ermahnungen Petrarcas entgegen, schiffte sich Urban V. nach Avignon ein, wo er kurz nach seiner Ankunft starb. Gleichwohl darf das Ziborium der Laterankirche als starkes Zeichen der Zuversicht gelten. Wenig über ein Jahrfünft brauchte es, bis die Päpste erneut ihren bis heute währenden Aufenthalt in Rom nahmen.
Die überflüssige Confessio
Auf die Confessio des Papstaltars ließe sich umstandslos verzichten. Ob sie bei der Anlage durch Papst Sergius II. Mitte des neunten Jahrhunderts oder später bedeutende Reliquien enthielt, ist ungewiss. Hinter dem Fenster zum Reliquienrepositorium unter dem Altar befindet sich seit offenbar Langem nichts Wesentliches. Ganz gegen den Sinn der Anlage. Der ist, ein Heiligengrab – häufig das eines Märtyrers – oder sonstige materielle Zeugnisse von hoher Bedeutung für den Glauben aufzunehmen, wie in S. Maria Maggiore des Christkindes vorgebliche Krippe. Gelegentlich wurde vorgeschlagen, hier sei die die nun in den Tisch des Papstaltars eingelassene Mensa Petri zur Schau gestellt worden. Indessen fehlt jeder Beleg.

Confessio. Foto Szilas
Heute über einem gestreckten U gegründet, in dessen Bogen eine doppelläufige Treppe installiert ist, weist die marmorvertäfelte Anlage in die Spätrenaissance, die Jahre der Ausstattung des Querhauses. Zwischen die Treppenläufe ließ Papst Pius IX. im Jahr 1853 Grab und bronzene Deckplatte seines spätmittelalterlichen Vorgängers Martin V. verbringen. Beide Kirchenoberhäupter reichten einander das Wasser. Pius IX. durch die Anmaßung päpstlicher Unfehlbarkeit bei Entscheidungen ex cathedra, mithin vom Lehrstuhl Petri herab, der Behauptung von Mariae „unbefleckter“ Empfängnis und dem wider die Moderne geschleuderten „Syllabus errorum“, der die vermeintlichen Irrtümer der Zeit wie wissenschaftlicher unter anderem Darwins Erkenntnisse und den Sozialismus verdammte. Der 1431 verstorbene Martin V. führte – noch als Kardinal – auf dem Konstanzer Konzil die Anklage wider Jan Hus. Ein glatter Justizmord. Entgegen der Zusage freien Geleits landete der böhmische Reformator auf dem Scheiterhaufen. Papst geworden, pochte der aus der Familie der Colonna stammende Pontifex auf seinen Primat über die Beschlüsse des Kirchenparlaments. Des papalen Prestiges halber ging Martin V. an die Renovierung der während der Verlagerung der Residenz der Tiaraträger nach Avignon und später in den Jahren von Päpsten und Gegenpäpsten vernachlässigten und heruntergekommenen Kapitale, besonders auch der Lateranbasilika. Des Papstes Grabplatte wurde ausweislich Zollliste aus Florenz eingeführt. Versierte Beherrschung des Flachreliefs weist das Grabdenkmal in die Werkstatt Donatellos oder womöglich dessen Bruder Simone Ghini. Jedenfalls sprechen wider die Hand des Meisters selbst offenbleibende Wünsche an die Virtuosität des Formenflusses.
Bischöfliche Liturgie mit bedauernswertem Chor
Das Pontifikalamt an gewöhnlichen Sonntagen im Jahreskreis macht nicht mehr als unbedingt nötig von sich her. Schon zur Terz findet sich das liturgische Personal am Papstaltar ein. Um die Andachts- mit Messgewändern zu vertauschen, kehren nach Beschluss des Stundengebets Zelebranten und Messdiener in die Sakristei zurück. Anrührend, wenn zur Überbrückung der Zeit bis zum Beginn der Messe ein gebrechlicher, doch Haltung wahrender Bischofsgreis mit Pileolus auf dem Haupt, in Soutane, Rochett, Mozetta und Rollstuhl durch das Gotteshaus spazieren gefahren wird. Über den Chor der Basilika lässt sich kaum etwas sagen. Die Mikrofonie ist grauenhaft. Der Chor kann wie aus dem Transistorradio tönen oder in die Stimmen der einzelnen Sängerinnen und Sänger zerlegt werden. Offenbar hat der bischöfliche Hauptzelebrant seinen Cicero und sonstige Rhetorik klassischen Altertums verinnerlicht. Parallelismus membrorum und Anapher leisten das Ihre, auf dass die Verkündigung selbst Gottesdienstbesuchende mit verbesserungsbedürftigem Italienisch erreicht. Jenseits liturgischer Spitzfindigkeiten und historischen Wandels gibt am Altar versammelt die vom gotischen Ziborium beschirmte Geistlichkeit beinahe den Anblick von Trecento-Malerei. Gut denkbar, der Spiritus Sanctust spricht hier aus dem Geist Giottos und seiner Kunstgenossen. – Gewiss entfernt sich alles dies äonenweit von der Schlichtheit der Gottesdienste in den frühchristlichen Hauskirchen wie jener der Fausta tief unter der Papstbasilika. Gott bedarf keines liturgischen Pomps. Bloßem Formalismus mangelt die Seele. Wo Äußerlichkeiten überhandnehmen, braucht es statt ihrer Einfachheit. Mag aber sein, ab und an erfreut Vater, Sohn und Heiligen Geist – sofern es nicht zu Eitelkeit und Selbstzweck missrät – das Extra.