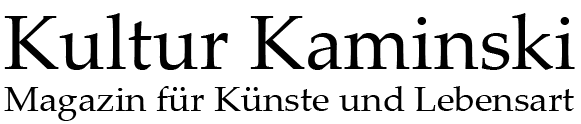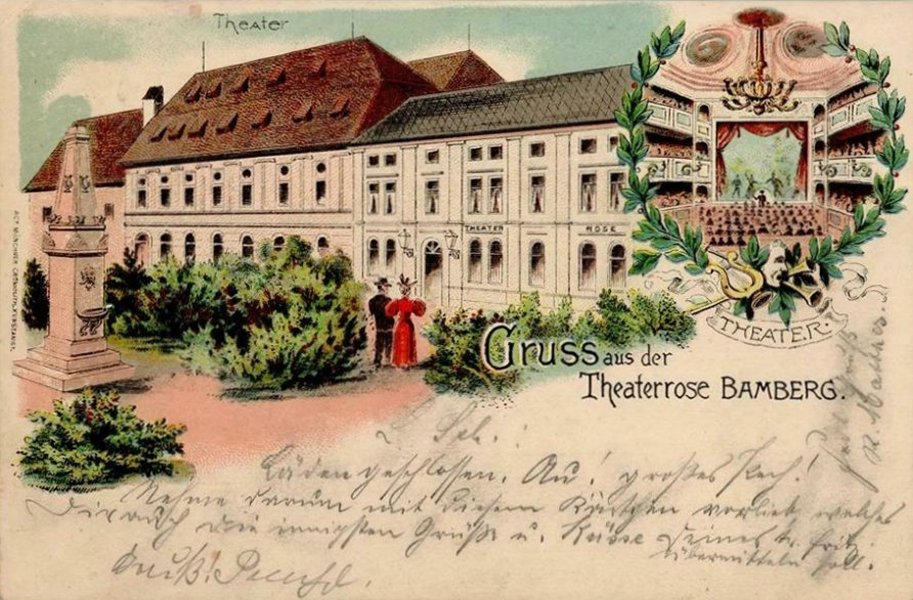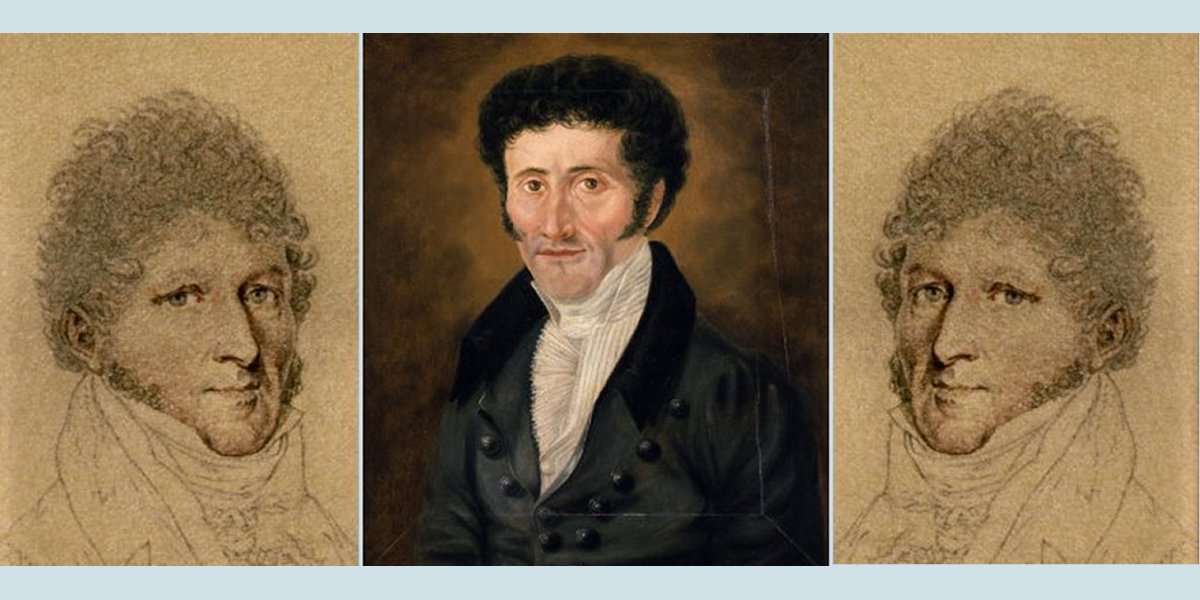Produktive und unproduktive Zerstörung
Der Chorraum der Lateranbasilika ärgert. Historismus der unangenehmsten Sorte aus den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Pseudo-rekonstruktiv. Gänzlich ohne Originalität. Geistlos. Freilich warf bereits der mittelalterliche Vorgänger Probleme auf. Ein Foto des Letzteren zeigt, wie ungünstig sich die geringe Tiefe auswirkte. Die Apsis schloss unmittelbar an das Querhaus. Optisch schien der Papstaltar beinahe vor die Wand gedrückt. Borrominis sicheres Auge erkannte die missliche Situation und sann auf Abhilfe. Innozenz X. freilich verwehrte ihm das Vorhaben.
Ob nun die Zeitnot hinsichtlich des bevorstehenden Heiligen Jahres, die Ehrwürdigkeit der konstantinischen Baugestalt oder beide den Ausschlag gaben, ist ungewiss. Zwar hatte Nikolaus IV. schon gegen Ende des 13. Jahrhunderts das marode aufgehende Mauerwerk abreißen lassen, doch die Apsis auf den frühchristlichen Fundamenten wiedererrichtet. Leo XIII. befahl 1881 die Niederlegung des Gebäudeteils. Sein Architekt Virginio Vespignani streckte die Chorpartie um 22 Meter und ließ sie in einer Kopie der mittelalterlichen Apsis münden. Marmorn prangt seit 1883 in ihrem Scheitel der klobige Papstthron, roh imitierte Gotik.
Die Apsismosaike
Die Geschichte der Apsis belegt erneut, was überdies für das Mittelschiff gilt: Wie Rücksicht auf die Gestalt der konstantinischen Basilika und entschiedener Wille zur Um- und Neugestaltung gegeneinander rangen.
Von den sicher bedeutenden frühchristlichen Mosaiken lag Nikolaus IV. einzig an deren ehrwürdigstem Ausschnitt, der Salvatorbüste. Ein Abbild jener Erscheinung vor Papst, Kaiser und allem Volk bei der Weihe der Lateranbasilika. Jedenfalls nach der der frommen Legende. Der erste Franziskaner auf der Cathedra Petri, beauftragte seinen Mitbruder im Orden Jacopo Torriti mit den Mosaiken für die Apsis, freilich mit der Maßgabe, die Salvatorbüste dortselbst nach wie vor in der Konche an prominenter Stelle zu einzufügen. So blickte sie denn von Engeln flankiert aus himmlischer Sphäre hernieder auf die Taube des Heiligen Geistes, aus deren Schnabel Wasser entlang eines Schmuckkreuzes fließt.
An dessen Fuß sammelt das Nass sich in einem See, von dem aus es sich in die die Hirsche und Lämmer tränkenden vier Paradiesesströme ergießt, um im fischreichen Jordan zu münden. Im Dreieck zwischen Paradiesesfluten und Jesu Taufgewässer erscheint das Himmlische Jerusalem. Links flankieren riesenhaft und im Zeigegestus die Gottesmutter samt Peter und Paul Kreuz und Ströme, auf der Rechten die beiden Johannes (Täufer und Evangelist) sowie der hl. Andreas. Ihnen nicht einmal bis an die Schulter reichend, positionieren sich hinter Maria der hl. Franz und hinter Johannes Baptista der hl. Antonius von Padua. Nikolaus IV. kniet zu Füßen der Gottesmutter. So verbinden sich denn im Mosaik der Konche das Salvator-Hauptpatrozinium und die Johannes-Nebenpatrozinien samt den beiden Apostelfürsten, deren Schädel im Ziborium des Papstaltars deponiert sind, mit massiv vorgetragener franziskanischer Propaganda.
Kopie als verbessertes Original
Mögen immer Franziskus und Antonius von Padua nicht zur Größe Mariens, des Täufers, der Apostel und des Evangelisten emporragen, der Papst – weil noch lebendig und nicht zur Ehre der Altäre erhoben – gar knien, keine sieben Jahrzehnte nach Tod des Ordensgründers hatten sich die Minderbrüder nicht allein auf der Cathedra Petri platziert, dauerhafter noch als der franziskanische Papst, nahmen sie im Konchenmosaik der ranghöchsten Kirche der Christenheit prominente Stellen ein. Bei aller demonstrativen Bescheidenheit expandierte der Orden nicht nur zu den einfachen Leuten hin, vielmehr in die Hierarchie hinein. Früh war der vom Stifter ganz der Armut verpflichtete Orden beim Marsch durch die klerikalen Institutionen erfolgreich. Im Apsiszylinder begegnen Ganzfiguren der zwölf Apostel.
Über den künstlerischen Rang des Apsismosaiks lässt sich nichts ausführen. Wer originale Werke Torritis sehen möchte, sollte S. Maria Maggiore besuchen oder sich gar in die Oberkirche von S. Francesco nach Assisi aufmachen. Das Mosaik in der Lateranbasilika ist eine müde und in den Details unzuverlässige Kopie. Denn zu einer verlässlichen Replik fehlten die Daten. Der Originalbefund war bei Abriss der spätmittelalterlichen Apsis und mit ihm der Zertrümmerung von Torritis Mosaik nur unzureichend dokumentiert worden. Reste vom Original sind nicht mehr aufzufinden. Noch für Nikolaus IV. sakrosankt, scheint selbst die frühchristliche Salvatorbüste zerschlagen worden zu sein. Der Doyen der Forschung über Roms mittelalterliche Kirchen Peter Cornelius Claussen vermutet eine restlose Tilgung durch „eine Ordre von ganz oben“. Zum einen, um durch Beseitigung des Streitgegenstands die empörten Einwände zahlreicher Gelehrter zu ersticken. Ferner, um dem Vergleich zwischen Original und Kopie jede Grundlage zu entziehen.
Letztere sollte in ihrer Ausführung über allen Zweifel erhaben sein. Auftraggeber Leo XIII. begriff die Replik offensichtlich als verbesserte Version des Originals. Von diesem Pontifex Maximus ging nicht allein die berühmte auf Linderung des erbarmungswürdigen Loses der Fabrikarbeiterschaft drängende Sozialenzyklika „Rerum Novarum“ aus. Die Moderne war nicht seine Sache. Seine Vorstellungen vom Papsttum rückwärtsgewandt. Ins Mittelalter. Abriss und Neubau der Apsis seiner Bischofskirche gaben den Impuls zur Inflation jener historistischen Gotteshäuser in romanischer und gotischer Manier, die heute eher befremden denn erfreuen. Des Chores der Lateranbasilika Seitenwände freilich gefallen sich den Stil des Querhauses aufnehmend und offenbar auf dessen Überbietung sinnend in kulissenhaft-pompöser Neorenaissance.
Der letzte Teil der kritischen Besichtigung wird sich mit dem Querhaus befassen.